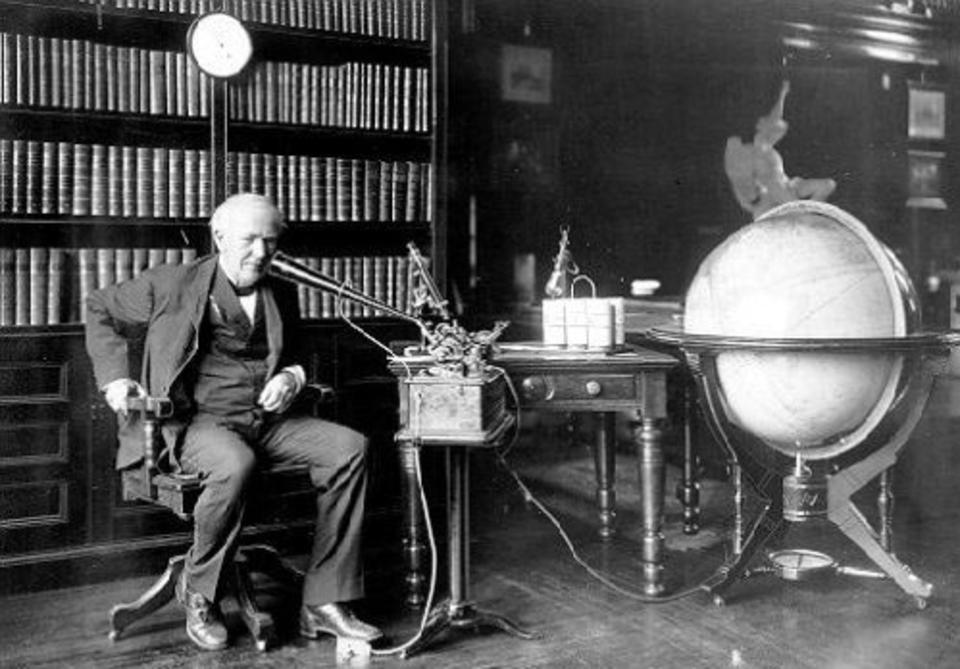Sie reichten nach rechts und links, so weit das Auge blicken konnte, ein endloses Meer aus Schubladen. Neugierig trat ich näher, mein Blick fiel auf einen Karteikasten mit der Aufschrift: „Menschen, die ich gemocht habe“. Zögernd öffnete ich ihn und begann, die Karten durchzublättern. Mit Erstaunen – nein, mit Schrecken – erkannte ich jeden einzelnen Namen. Schnell schloss ich den Kasten wieder. In diesem Moment wusste ich, wo ich war. Ohne dass es mir jemand erklären musste, verstand ich: Dieses Zimmer war ein Archiv meines Lebens, jedes Detail genauestens aufgezeichnet.
Jeder Augenblick, jede Tat, ob groß oder klein, war hier festgehalten. Mein Gedächtnis hätte niemals all diese Informationen bewahren können. Verwundert und gleichzeitig von einer unheimlichen Neugier getrieben, begann ich, wahllos andere Karteikästen zu öffnen. Einige zauberten mir ein Lächeln ins Gesicht, weckten Erinnerungen an schöne Zeiten. Andere erfüllten mich mit Scham, ließen mich erschauern. Instinktiv sah ich mich um, als ob jemand mich dabei beobachten könnte.
Die Beschriftungen waren vielfältig: „Bücher, die ich gelesen habe“, „Lügen, die ich erzählt habe“, „Trost, den ich gespendet habe“, „Worte, die ich meinen Geschwistern an den Kopf geworfen habe“, „Witze, über die ich gelacht habe“. Manches war so detailliert, dass ich schmunzeln musste. Doch andere Kategorien trafen mich hart: „Dinge, die ich in Wut getan habe“, „Gedanken, mit denen ich andere verurteilt habe“.
Ich konnte nicht aufhören, mich zu wundern. Manchmal gab es mehr Karten, als ich befürchtet hatte, manchmal weniger, als ich gehofft hatte. Die schiere Menge überwältigte mich. Hatte ich all das wirklich in 52 Jahren meines Lebens erlebt? Doch jede Karte bewies es. Jede trug meine Handschrift, jede war mit meiner Unterschrift versehen.
Als ich den Karteikasten „Musik, die ich gehört habe“ herauszog, wuchs er, um den Inhalt zu fassen. Ich blätterte und blätterte, aber das Ende schien nie zu kommen. Schließlich gab ich auf, beschämt nicht wegen der Musik, sondern wegen der Zeit, die ich damit verbracht hatte.
Dann entdeckte ich den Kasten „Lustvolle Gedanken“. Zitternd zog ich ihn ein paar Zentimeter heraus, gerade genug, um eine Karte zu entnehmen. Ich wollte gar nicht wissen, wie groß der Kasten wirklich war. Die Details auf den Karten ließen mich erschauern. Ich fühlte mich ertappt, gedemütigt und wütend. „Niemand darf das je sehen! Ich muss diese Karten vernichten!“, dachte ich verzweifelt. Doch egal, wie sehr ich es versuchte – ich konnte sie weder herausreißen noch zerreißen.
Geschlagen und hilflos schob ich den Kasten zurück. Mit der Stirn gegen das Regal gelehnt, entfuhr mir ein Seufzer voller Selbstmitleid.
Da entdeckte ich ihn: den Karteikasten mit der Aufschrift „Menschen, denen ich das Evangelium weitergesagt habe“. Der Griff war heller als die anderen – kaum benutzt. Ich zog ihn heraus. In meinen Händen lag eine winzige Schachtel, kaum zehn Zentimeter lang. Die wenigen Karten darin konnte ich an einer Hand abzählen. Tränen stiegen mir in die Augen, tiefe Schluchzer rissen mich zu Boden. Ich weinte vor Scham und Schmerz.
„Niemand darf je von diesem Zimmer erfahren. Ich muss es verschließen und den Schlüssel für immer verstecken.“, flüsterte ich verzweifelt.
Doch dann geschah es. Ich sah Ihn.
Er betrat das Zimmer. Nein – nicht Er. Nicht hier. Jeder, nur nicht Jesus.
Ich konnte nicht weglaufen, nicht verhindern, dass Er sich umsah. Er begann, die Karteikästen zu öffnen, las meine Karten, und jedes Mal durchzuckte mich ein Stich. In Seinem Gesicht lag unendliche Traurigkeit, die mein Herz zerriss.
Schließlich drehte Er sich zu mir um. Sein Blick war voller Mitgefühl – kein verurteilendes, sondern ein mitleidvolles Mitgefühl. Ich brach erneut in Tränen aus, verbarg mein Gesicht in meinen Händen.
Er kam zu mir, legte sanft Seinen Arm um mich. Er sagte nichts. Er weinte einfach mit mir.
Dann stand Er auf und ging zur Wand der Karteikästen. Einen nach dem anderen zog Er heraus und begann, Seinen Namen über meinen zu schreiben.
„Nein!“, rief ich verzweifelt, „das darfst Du nicht! Dein Name soll nicht auf diesen Karten stehen!“ Ich griff nach einer Karte, wollte sie Ihm entreißen. Doch da war es schon: In kräftigem Rot, geschrieben mit Seinem Blut, stand Sein Name über meinem.
Sanft nahm Er die Karte zurück. Mit traurigem Lächeln fuhr Er fort, Karte um Karte zu unterschreiben. Ich weiß nicht, wie Er es so schnell schaffte, aber im nächsten Moment schloss Er den letzten Karteikasten. Er kehrte zu mir zurück, legte Seine Hand auf meine Schulter und sprach:
„Es ist vollbracht.“